Berylliumcarbid
| Kristallstruktur | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
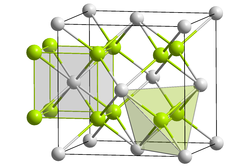
| ||||||||||||||||||||
| __ Be2+ __ C4− | ||||||||||||||||||||
| Allgemeines | ||||||||||||||||||||
| Name | Berylliumcarbid | |||||||||||||||||||
| Verhältnisformel | Be2C | |||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 506-66-1 | |||||||||||||||||||
| Kurzbeschreibung |
gelbrote Kristalle[1] | |||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||
| Molare Masse | 30,03 g·mol−1 | |||||||||||||||||||
| Aggregatzustand |
fest | |||||||||||||||||||
| Dichte |
1,90 g·cm−3 (20 °C)[1] | |||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | ||||||||||||||||||||
| Löslichkeit |
reagiert langsam mit Wasser[1] | |||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | ||||||||||||||||||||
Berylliumcarbid ist eine chemische Verbindung, die aus Beryllium und Kohlenstoff besteht.
Herstellung
Berylliumcarbid kann aus den Elementen hergestellt werden.[1] Bei 900 °C setzt eine exotherme Reaktion ein, die das Reaktionsgemisch auf 1400 °C erhitzt.[4]
Ebenso ist die Reaktion von Berylliumoxid und Kohlenstoff bei hoher Temperatur möglich.[5]
Bei höheren Temperaturen entsteht Kohlenmonoxid.[6]
Eigenschaften
Berylliumcarbid bildet gelbrote kubische[7] Kristalle, die langsam mit Wasser unter Bildung von Berylliumhydroxid und Methan reagieren.[5]
Da das entstehende Berylliumhydroxid amphoter ist, wird die Reaktion in Anwesenheit von Alkalihydroxiden unter Bildung von wasserlöslichen Beryllaten beschleunigt.[8]
Daraus ergibt sich für die gesamte wasserkatalysierte Reaktion:
Fluor, Chlor und Brom reagieren mit Berylliumcarbid in der Hitze zu den entsprechenden Berylliumhalogeniden unter Bildung von Kohlenstoff.[5]
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Dale L. Perry, Sidney L. Phillips: Handbook of inorganic compounds. CRC Press, 1995, ISBN 978-0-8493-8671-8, S. 62 (eingeschränkte Vorschau in der Google Buchsuche).
- ↑ 2,0 2,1 Nicht explizit in EU-Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) gelistet, fällt aber dort mit der angegebenen Kennzeichnung unter den Sammelbegriff „Berylliumverbindungen“; Eintrag aus der CLP-Verordnung zu Berylliumverbindungen in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 13. März 2011 (JavaScript erforderlich)
Referenzfehler: Ungültiges
<ref>-Tag. Der Name „CLP_82790“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. - ↑ Seit 1. Dezember 2012 ist für Stoffe ausschließlich die GHS-Gefahrstoffkennzeichnung zulässig. Bis zum 1. Juni 2015 dürfen noch die R-Sätze dieses Stoffes für die Einstufung von Zubereitungen herangezogen werden, anschließend ist die EU-Gefahrstoffkennzeichnung von rein historischem Interesse.
- ↑ Kenneth A. Walsh: "Beryllium chemistry and Processing", ASM International (2009). p. 117 (eingeschränkte Vorschau in der Google Buchsuche)
- ↑ 5,0 5,1 5,2 C. L. Parsons: "The Chemistry and Literature of Beryllium", Chemical Publishing (1909), p. 26. Volltext
- ↑ K. Motzfeld: "Equilibrium of the Reaction between Beryllium Oxide and Carbon to Give Beryllium Carbide" in Acta Chemica Scandinavica 1964, 18, p. 495-503. doi:10.3891/acta.chem.scand.18-0495
- ↑ Eintrag bei chemicals.etacude.com
- ↑ Vorlesungsskriptum: "Chemie der Metalle", Universität Freiburg